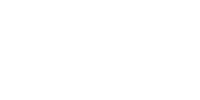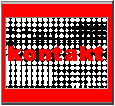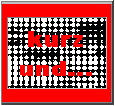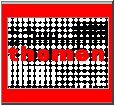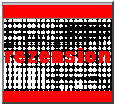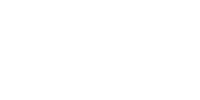
Ein Gespräch
mit Mordecai Richler
|
Mordecai Richler:
Wie Barney es sieht
Roman.
Hanser Verlag, 2000.
475 S.
Ganz im Gegensatz zu landläufigen Meinungen kommen die unterhaltsamsten, witzigsten Bücher dieser Tage eher selten von knackigen jungen Frauen sondern vielmehr von schlaffen alten Männern. Zu nennen wären da Philip Roth, Tom Wolfe oder Steve Tesich: allesamt glänzende Satiriker, die nichts und niemanden schonen, die aber nicht mehr posieren, etwas beweisen müssen. Nicht umsonst wohl auch sind alle Genannten englischsprachige Autoren: Sie kommen aus einer Kultur, in der die Gesellschaftssatire eine große Tradition hat, und in der die Verachtung als gesellschaftliche Grundhaltung nicht so ausgeprägt ist wie beispielsweise in Deutschland oder Frankreich.
So besteht ein entscheidender Unterschied zwischen Brett Easton Ellis einerseits, Michel Houellebecq oder Christian Kracht, sogar Stuckrad-Barre andererseits darin, dass bei letztgenannten echte Verachtung, ja Ekel, ausgelebt wird, während dies bei Ellis in satirischer, man muss sogar sagen, anklagender Absicht demonstriert wird.
Radikale Satire fusst auf einer gewissen, wenngleich grummeligen Sympathie für die Menschen und ihre merkwürdigen Verhaltensweisen, und das schliesst die eigene Person ein. Gefragt ist also eine Mischung aus Distanz und Identifikation mit sich selbst und der Gesellschaft, was darauf hinausläuft, dass dem Gesellschaftssatiriker nichts peinlich sein darf.
Und peinlich ist Barney, der in Mordecai Richlers Buch im Angesicht drohenden Alzheimers seine Lebensbeichte ablegt, nun wirklich kaum etwas. Nicht seine äusserst kleinbürgerliche Herkunft aus dem jüdischen Einwanderer Milieu in Montreal, nicht seine mangelnde schulische Ausbildung. Auch seine Stellung als Mitläufer im Pariser Künstlermilieu der 50iger Jahre verschweigt Barney nicht, ebenso wenig wie Tatsache, dass er später zu Wohlstand kommt durch die Produktion von grauenhaft schlechten Fernsehserien. Nicht mal mit seinen zunehmenden Problemen mit Gedächtnis oder Blase hält er hinterm Berg.
Dabei ist Barney ein Aufschneider, er flunkert, er weicht aus, schweift ab, wo es nur geht oder eben auch nicht geht, er schmückt sich mit fremden Federn, er schmäht, beleidigt, fälscht, was das Zeug hält.
Und er ist grenzenlos sentimental, denn nach zwei gescheiterten Ehen hat ihn auch Miriam, Frau seines Lebens, mit der er drei Kinder hat, verlassen.
Mordecai Richler, geb. 1931 in Montreal, gilt in Kanada längst als einer der ganz Großen. In Deutschland hat er den Durchbruch noch nicht geschafft. Sein letzter Roman, "Solomon Gursky", wurde nur mässig beachtet. Auch diesem Buch wird wohl der ganz grosse Erfolg verwehrt bleiben.
Das, was man in Deutschland gemeinhin mit Kanada verbindet, findet bei Richler kaum statt. Er ist ein Großstädter, fast schon ein Kosmopolit. Wie sein Held Barney verbrachte Richler einige Jahre in Paris und überwintert heute regelmässig in London. Das weite Land, das Leben in der rauhen Natur taugt in diesem Roman nur als Hintergrund für eine ziemlich grimmige Pointe zu der Frage, die Barney ununterbrochen beschäftigt: Ist er ein Mörder? Hat er seinen besten Freund umgebracht, wie die meisten Menschen glauben?
Barney selbst kann diese Frage nicht mehr klären, sowenig, wie er seinen Lebensbericht vollenden kann: Er verfällt vorher der Alzheimerschen Krankheit, sein Gedächtnis, mit dem er schon den Bericht hindurch zu kämpfen hat, verlässt in vollends. Mit einem Nachwort und vielen Korrekturen in Fussnoten versehen ist der Bericht von seinem Sohn. Diese Korrekturen allerdings beziehen sich immer nur auf nachprüfbare Fakten und Daten. Das Skelett der Geschichte, die Geschichten seines Lebens hingegen lassen sich weder veri- noch falsifizieren. Ihr Wahrheitsgehalt steht und fällt mit den Gedächtnissen der daran Beteiligten.
Man kann in diesem Buch durchaus einen modernen Roman sehen, in dem Sinne, dass er das Wesen des Erzählens und des Erinnerns selbst reflektiert. Man kann dem Autor auch eine tiefe melancholische Altersweisheit unterjubeln. In erster Linie aber ist diese Buch erstklassige Unterhaltung, die weder an satirischen Ausfällen in alle erdenklichen Richtungen spart noch sich vor offenem Slapstick scheut. Vorbilder und Referenzen nennt das Werk gleich selbst, allen voran - und hierin ebenso grossmäulig wie sein Protege - Boswells Life of Samuel Johnson.
|
|