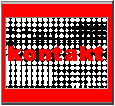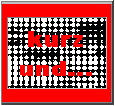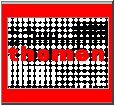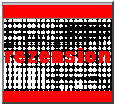|
Die Kunst des Versiebens
Jim Dodge:
Die Kunst des Verschwindens.
Roman. Rowohlt, 2000.
494 S.
Thomas Pynchon, großer Versteckspieler und zur Zeit rätselhaftester der amerikanischen Autoren, mag Jim Dodge´s Roman:
„Die Kunst des Verschwindens» zu lesen ist, als würde man eine endlose Party feiern, zu Ehren aller Dinge, auf die es wirklich ankommt.“ informiert uns die Kehrseite des Buches, das jetzt als Rowohlt Paperback vorliegt.
Klingt vielversprechend und werbewirksam. Pynchon ließ es sich auch nicht nehmen, ein Vorwort zu verfassen, in dem er das Problem einer vernetzten und elektronisch überwachten Gesellschaft thematisiert, dem sich heute auch Autoren nicht mehr entziehen können. Doch erschien, so Pynchon weiter, der Roman erstmals 1989, also genau an der Grenze zu einer sich digital neu generierenden Gesellschaft, der sich dieser „bewußt analoge Roman“ erfolgreich entzieht, um zugleich ihre kommende Entwicklung zu antizipieren.
Tut er nicht! Was da auf 576 Seiten ausgebreitet wird, ist eine Art umgekehrter moderner Western, ein zu spät gekommener Hippie-Roman, voller Outlaws, die sich dem klassischen „American way of life“ zu entziehen versuchen, um als Pioniere den amerikanischen Traum von Freiheit zu reanimieren. Nicht eine Antizipation, sondern ein Revival findet statt, wenn nicht gar ein letztes Aufbäumen der analogen Welt. Protagonist Daniel Pearse entzieht sich der digitalen Welt nicht, sondern wird in die verschwindende analoge hinein geboren.
Daniels 16-jährige Mutter, Annalee Faro Pearse, bringt ihn in einer Jugendstrafanstalt zur Welt, als Väter kommen sieben verschiedene Männer in Frage. Sie muß verschwinden und trifft auf ihrer ziellosen Reise auf Smiling Jack, der ihr ein Haus zum kostenfreien Wohnen anbietet - wenn sie im Gegenzug ein paar Freunden Unterschlupf gewährt. Wie sich später herausstellt gehören diese Flüchtlinge zu einer Organisation mit dem Namen AMO, einem geheimen internationalen Bund von „Outlaws und Freigeistern“, zu denen Anarchisten, Schamanen, Erdmystiker und andere Leute gehören, die sich eher an den Rändern der Gesellschaft bewegen. Was die AMO für übergeordnete Ziele verfolgt, wird nie hinreichend erklärt, aber ihre Anhänger scheinen, trotz ihrer Schwächen für Diebstahl, Drogen und Magie, die Guten zu sein.
Statt in der Schule „unnützes“ Wissen anzuhäufen, lernt Daniel die wichtigen Dinge des Lebens von den Gästen des Hauses: wäre die Welt ein Wildwestfilm, er wäre vorbereitet.
Als das FBI von der Existenz des Verstecks erfährt, flieht die Kleinfamilie und landet in Berkley, Kalifornien, wo Annalee ums Leben kommt, als eine von ihr gelegte Bombe explodiert, mit der sie den Plutonium-Klau ihres Freundes Shamus unterstützen wollte. Daniel, der dabei war, glaubt nicht an einen Unfall, da seine Mutter ihm vor der Explosion noch ein „Lauf weg!“ zurief.
Volta, ein Magier und hoher Funktionär der Organisation, nimmt Daniel unter seine Fittiche. Er verspricht, herauszufinden, wer seine Mutter umgebracht hat. Bis dahin aber schickt er Daniel in die „Lehre“. Bei einem Profi-Einbrecher lernt er das Einbrechen, bei einem Spieler professionelles Zocken und bei einem Verkleidungskünstler die Kunst, andere Leute perfekt zu imitieren.
Anschließend trifft er einen Drogenfreak, der nicht nur alle Arten von Drogen anbaut, sondern auch ein paar willige Mädels kennt, von denen Daniel lernt, was es mit dem Sex auf sich hat, doch – tragisch - er kann mit jeder Frau nur ein einziges Mal schlafen. Das Meditieren lernt er von Wild Bill, der Daniel als Überlebenstraining zwei Wochen in einer Höhle hausen läßt – der Traum jedes Pfadfinders.
Dann ist es soweit: Volta – der Meister höchstpersönlich - führt ihn, da er sich als gelehriger Schüler erwiesen hat, in die Kunst des Verschwindens ein. Das geht recht zügig, bald kann Daniel sich nach Belieben unsichtbar machen, was sich gut trifft, als er einen mystisch-magischen Diamanten stehlen soll, der ein Rätsel verbirgt, aber vom Militär mit der raffiniertesten Technik bewacht wird. Daniel klaut den Klunker und ergründet sein Geheimnis, jedoch erst, als er seine wahre Liebe gefunden hat. Zuletzt lernen wir auch den Mörder seiner Mutter kennen.
DDer Roman markiert, wie Pynchon richtig erkannt hat, tatsächlich das Ende einer Zeit. Aber er antizipiert nichts Neues und wäre man böswillig, könnte man sagen, er kommt schlicht und einfach zu spät. Beim Lesen fällt einem plötzlich wieder dieser Text ein, den Leslie A. Fiedler 1968 schrieb. In „Cross the border, close the gap“ verlangte er nach einer neuen, postmodernen Kritik, die den Büchern dieser „antirationalen, offen romantischen“ Zeit angemessen sei. Zeitgemäße mythische Genres wie Western, Science- Fiction oder Porno könnten eben nicht mit einer an James Joyce geschulten akademischen Kritik auseinander genommen werden. Fiedler sah in diesen Pop-Art-Romanen die mythische Unschuld Amerikas überleben, in der Erinnerung an die risikofreudigen amerikanischen Siedler, die mit ihren Trecks nach Westen zogen, um das gelobte Land zu erschließen.
Diesen Mythos bedient auch „Die Kunst des Verschwindens“, indem er Magie als Mittel akzeptiert und die Suche nach dem Stein des Weisen zu seinem Sujet wählt. Synchron ist es der Bildungsroman des Daniel Pearse, der in seinem ständigen Unterwegs-Sein nach der eigenen Identität sucht.
Doch im Gegensatz zum erfolgreichen Daniel findet der Roman seine zeitliche Identität zu spät. Er ist ein Anachronismus und dazu noch ein mäßig geschriebener. Dabei sollte es Jim Dodge, der – wie die Rückseite des Buches belehrt- Creative Writing unterrichtet, eigentlich besser wissen.
Es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, gut verkäufliche Romane zu schreiben, die spannend und auch lesbar sind, zumal sich aus dem gewählten Stoff etwas hätte machen lassen. Aber die Figuren von Dodge sind eindimensional gezeichnet und unterhalten sich in einer Sprache, die ihre Konstruiertheit nur schwer verbergen kann. Das Auftauchen einiger Figuren, die im weiteren Verlauf des Romans keine tragende Rolle mehr spielen, ist motivationstechnisch ungeschickt. Einige Schlüsselszenen werden lange vorbereitet und verebben dann auf zwei Seiten gänzlich unspektakulär, während unwichtige Szenen sich über zwanzig Seiten hinziehen. Der Diebstahl des Diamanten ist ein typischer Fall – alles ist von langer Hand geplant, dann spaziert Daniel unsichtbar in den unterirdischen Bunker, um eine Seite später mit dem Diamanten an die Erdoberfläche zurückzukehren. Statt Stringenz regiert in der gesamten Geschichte die Geschwätzigkeit. Ebenso verpufft die Wirkung des Krimis, da die Auflösung dieses quälend langen Verwirrspiels am Ende des fast sechshundertseitigen Romans schon gar nicht mehr interessiert.
Zwar hätte Leslie A. Fiedler die Idee des Romans sicherlich gut gefunden, denn er kommt aus der mythisch-mystischen Ecke, wo Pioniere noch neue – wenn auch geistig-spirituelle - Gebiete erobern, für die er sich seine neue Art von Kritik wünschte. Ob er aber mit der platten Realisierung einverstanden gewesen wäre, ist zweifelhaft.
So bleibt die „Kunst des Verschwindens“ lediglich ein mittelmäßiger Roman, vielleicht, weil die Welt innerhalb der letzten zehn Jahren zunehmend digitalisiert wurde, vermutlich aber eher, weil die Kunst der einfachen, verkäuflichen Geschichten auch heute noch darin besteht, sie gut zu erzählen.
Kristian Kißling
|
|